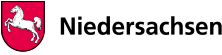7. KIP NI-Jahresveranstaltung am 13.11.2024 in Hannover hat stattgefunden
Das Kompetenzforum Islamismusprävention Niedersachsen (KIP NI) hat seine siebte Jahresveranstaltung zum Thema
"Deradikalisierungsarbeit im Spannungsfeld von Prävention und Repression"
am 13. November 2024.
in Hannover durchgeführt.
Die Presseinformation können Sie in der rechten Spalte herunterladen.
Die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, begrüßte die rund 150 Gäste und wies auf die guten Erfahrungen der Zusammenarbeit innerhalb des KIP NI sowie dessen Vorbildfunktion auch auf Bundes- und internationaler Ebene hin. In Bezug auf das Thema der Tagung betonte die Ministerin:
"Das bestehende Spannungsfeld zwischen Repression und Prävention im Bereich des Islamismus macht eine genaue Abstimmung erforderlich: In dem multiprofessionellen und Ressort übergreifenden Setting der Islamismusprävention in Niedersachsen müssen alle Akteure ihre jeweiligen Rollen kennen und wissen, wann ihr jeweiliges Handeln gefragt ist."
Anschließend stellten die zwei Geschäftsführerinnen des KIP NI, Daniela Schlicht, Verfassungsschutz Niedersachsen, und Lisa Borchardt, Landeskriminalamt Niedersachsen, den Geschäftsbericht vor. Dabei wiesen sie auch auf die Notwendigkeit hin, die richtige Balance zwischen Sicherheitsbelangen und präventiven Maßnahmen zu finden – welche im KIP NI gezielt ausgelotet werden.
"Präventionsarbeit erfordert Fingerspitzengefühl und einen kontinuierlichen Austausch aller beteiligten Akteure, aber auch ein Bewusstsein im gesamtgesellschaftlichen Kontext."
Jamuna Oehlmann endete in ihrem "Call-to-Action" mit dem Wunsch eines intensiveren Dialogs zwischen Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft, um gemeinsam an nachhaltigen Präventionsansätzen zu arbeiten und Rollenklarheit herzustellen.
Im zweiten Fachvortrag zum Thema "Erkennen, vernetzen, stärken: zum Wert der akteursübergreifenden Zusammenarbeit in der Islamismusprävention von Bund und Ländern" ging Christoph Dieter vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf die Herausforderungen in der Islamismusprävention ein und benannte dabei das "Kraftfeld" zwischen Repression und Prävention. Durch die Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure sei ein koordiniertes Handeln auf Vertrauensbasis und mithilfe offener Kommunikation zwar eine Herausforderung, aber zugleich auch eine Stärke, um der Dynamik und Komplexität der Fallkonstellationen zu begegnen. Mittels eines Praxisbeispiels verdeutlichte er die Relevanz eines ganzheitlichen Umgangs in der Islamismusprävention. Im Ausblick stellte er die von der Bundesregierung eingesetzte Task Force Islamismusprävention als neuen Impuls zur akteursübergreifenden Zusammenarbeit vor, bei welcher Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung von präventionspraktischen Ansätzen v. a. im Bereich des Internet-beeinflussten Radikalisierungsgeschehens und der Online-Prävention erarbeitet werden sollen.
Im dritten und letzten Vortrag mit dem Titel "Verfolgungsdruck, wahrgenommene Perspektivlosigkeit und Unsicherheit als Risikofaktoren für extremistische Gewalt" befasste sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundekriminalamts, Dr. Katharina Seewald, mit den im Titel genannten drei Risikofaktoren aus psychologischer Perspektive. Sie kommt zu dem Schluss:
"Ein Mangel an Lebensperspektiven bzw. eine wahrgenommene Bedeutungslosigkeit kann den Rückbezug auf extremistische Ideologien zur Folge haben, indem Sinnhaftigkeit, Bedeutung, Gruppenzugehörigkeit und auch höhere Ziele propagiert werden."
Extremistische Einstellungen und Überzeugungen helfen, wenn eigene Bewältigungsmechanismen nicht mehr ausreichen, indem sie gefühlte Sicherheit suggerieren. Eine Gruppenzugehörigkeit sei einem gesteigerten Sicherheitsgefühl zuträglich.
In der nachmittäglichen Podiumsdiskussion erörterten Jamuna Oehlmann, Dr. Katharina Seewald, Dieter Uden vom Aussteigerprogramm Aktion Neustart des Verfassungsschutzes Niedersachsen und der Journalist Florian Flade unter der Moderation der Journalistin Dilek Üşük die Fragestellung, inwiefern sich Repression und Prävention in der Deradikalisierungsarbeit ergänzen und bedingen, jedoch auch, inwieweit sie in direkter Konkurrenz zueinanderstehen. Insbesondere der Begriff des "Kraftfeldes", welchen Christoph Dieter in seinem Vortrag nutzte, wurde nochmal positiv aufgegriffen, da er das Potenzial und mögliche Chancen des Verhältnisses zwischen Repression und Prävention aufzeigt.
Eine Gleichzeitigkeit von Prävention und Repression sieht Dieter Uden als möglich an:
"Durch staatliche Repression wird Druck erzeugt, welcher wiederum eine Irritationsbereitschaft bei der betroffenen Person erzeugen und zu einer positiven Veränderung führen kann."
Thematisiert wurde zudem der Einfluss von Medien. Florian Flade:
"Extremismus ist eine Idee und es gilt, eine bessere Idee zu schaffen."
Insgesamt lässt sich aus der Veranstaltung folgender Schluss ziehen, den Innenministerin Behrens bereits in ihrer Einleitung anregte:
"Das bestehende Spannungsfeld zwischen Repression und Prävention im Bereich des Islamismus macht eine genaue Abstimmung erforderlich: In dem multiprofessionellen und Ressort übergreifenden Setting der Islamismusprävention in Niedersachsen müssen alle Akteure ihre jeweiligen Rollen kennen und wissen, wann ihr jeweiliges Handeln gefragt ist."
Anschließend stellten die zwei Geschäftsführerinnen des KIP NI, Daniela Schlicht, Verfassungsschutz Niedersachsen, und Lisa Borchardt, Landeskriminalamt Niedersachsen, den Geschäftsbericht vor. Dabei wiesen sie auch auf die Notwendigkeit hin, die richtige Balance zwischen Sicherheitsbelangen und präventiven Maßnahmen zu finden – welche im KIP NI gezielt ausgelotet werden.
Im ersten Fachvortrag mit dem Titel "Islamismusprävention und ihre Nebenwirkungen: Reflexion über nicht-intendierte Effekte" stellte Jamuna Oehlmann in ihrer Funktion als Co-Geschäftsführerin die Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus e. V. (BAG RelEx) als eine Plattform für Vernetzung, fachlichen Austausch, inhaltliche Weiterentwicklung und Interessenvertretung der zivilgesellschaftlichen Träger im Arbeitsfeld der Demokratieförderung und Prävention von religiös begründetem Extremismus vor. Im Rahmen der unbeabsichtigten Nebenfolgen von Islamismusprävention ging sie auf die Punkte Stigmatisierung, die Aussprache von Generalverdachten und die "Versicherheitlichung" der Präventionslandschaft genauer ein. Zentrale Elemente, um den genannten Herausforderungen zu begegnen, seien u. a. eine kritische Selbstreflexion, ein langfristiger Aufbau und Erhalt von Vertrauen durch transparente und differenzierte Zielgruppenansprache, strukturelle Änderungen insbesondere bei der Finanzierung von Projekten sowie letztlich die Normalisierung muslimischer Lebenswelten in der Gesellschaft. Sie konstatiert:
"Präventionsarbeit erfordert Fingerspitzengefühl und einen kontinuierlichen Austausch aller beteiligten Akteure, aber auch ein Bewusstsein im gesamtgesellschaftlichen Kontext."
Jamuna Oehlmann endete in ihrem "Call-to-Action" mit dem Wunsch eines intensiveren Dialogs zwischen Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft, um gemeinsam an nachhaltigen Präventionsansätzen zu arbeiten und Rollenklarheit herzustellen.
Im zweiten Fachvortrag zum Thema "Erkennen, vernetzen, stärken: zum Wert der akteursübergreifenden Zusammenarbeit in der Islamismusprävention von Bund und Ländern" ging Christoph Dieter vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf die Herausforderungen in der Islamismusprävention ein und benannte dabei das "Kraftfeld" zwischen Repression und Prävention. Durch die Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure sei ein koordiniertes Handeln auf Vertrauensbasis und mithilfe offener Kommunikation zwar eine Herausforderung, aber zugleich auch eine Stärke, um der Dynamik und Komplexität der Fallkonstellationen zu begegnen. Mittels eines Praxisbeispiels verdeutlichte er die Relevanz eines ganzheitlichen Umgangs in der Islamismusprävention. Im Ausblick stellte er die von der Bundesregierung eingesetzte Task Force Islamismusprävention als neuen Impuls zur akteursübergreifenden Zusammenarbeit vor, bei welcher Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung von präventionspraktischen Ansätzen v. a. im Bereich des Internet-beeinflussten Radikalisierungsgeschehens und der Online-Prävention erarbeitet werden sollen.
Im dritten und letzten Vortrag mit dem Titel "Verfolgungsdruck, wahrgenommene Perspektivlosigkeit und Unsicherheit als Risikofaktoren für extremistische Gewalt" befasste sich die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bundekriminalamts, Dr. Katharina Seewald, mit den im Titel genannten drei Risikofaktoren aus psychologischer Perspektive. Sie kommt zu dem Schluss:
"Ein Mangel an Lebensperspektiven bzw. eine wahrgenommene Bedeutungslosigkeit kann den Rückbezug auf extremistische Ideologien zur Folge haben, indem Sinnhaftigkeit, Bedeutung, Gruppenzugehörigkeit und auch höhere Ziele propagiert werden."
Extremistische Einstellungen und Überzeugungen helfen, wenn eigene Bewältigungsmechanismen nicht mehr ausreichen, indem sie gefühlte Sicherheit suggerieren. Eine Gruppenzugehörigkeit sei einem gesteigerten Sicherheitsgefühl zuträglich.
In der nachmittäglichen Podiumsdiskussion erörterten Jamuna Oehlmann, Dr. Katharina Seewald, Dieter Uden vom Aussteigerprogramm Aktion Neustart des Verfassungsschutzes Niedersachsen und der Journalist Florian Flade unter der Moderation der Journalistin Dilek Üşük die Fragestellung, inwiefern sich Repression und Prävention in der Deradikalisierungsarbeit ergänzen und bedingen, jedoch auch, inwieweit sie in direkter Konkurrenz zueinanderstehen. Insbesondere der Begriff des "Kraftfeldes", welchen Christoph Dieter in seinem Vortrag nutzte, wurde nochmal positiv aufgegriffen, da er das Potenzial und mögliche Chancen des Verhältnisses zwischen Repression und Prävention aufzeigt.
Eine Gleichzeitigkeit von Prävention und Repression sieht Dieter Uden als möglich an:
"Durch staatliche Repression wird Druck erzeugt, welcher wiederum eine Irritationsbereitschaft bei der betroffenen Person erzeugen und zu einer positiven Veränderung führen kann."
Thematisiert wurde zudem der Einfluss von Medien. Florian Flade:
"Extremismus ist eine Idee und es gilt, eine bessere Idee zu schaffen."
Extremisten nutzen die sozialen Medien, insbesondere TikTok sehr effizient. Das Feld dürfe den Extremisten nicht allein überlassen werden. Bestätigt wurde von allen Teilnehmenden des Podiums die Notwendigkeit des Ausbaus der Kommunikation von Wissenschaft, Politik, zivilen Trägern und Sicherheitsbehörden. Auch sei der Bereich des Streetwork und der Online-Prävention stärker in den Fokus zu nehmen, um dem Hass im Netz Einhalt zu gebieten. Insbesondere die Schulung der Medienkompetenz im jungen Alter zur Schaffung einer Resilienz und eines Bewusstseins für extremistische Inhalte sei laut Florian Flade essenziell.
Insgesamt lässt sich aus der Veranstaltung folgender Schluss ziehen, den Innenministerin Behrens bereits in ihrer Einleitung anregte:
"Es gilt zu verhindern, dass zu früh repressive Maßnahmen ergriffen und ggf. eine Radikalisierung dadurch erst verschärft oder ausgelöst wird. Und das gilt gleichermaßen auch anders herum: Dass Sicherheitsbelange zu spät berücksichtigt werden und das Durchführen repressiver Maßnahmen erforderlich gewesen wäre. Wichtig ist bei all dem Dreierlei:
- Es braucht eine vertrauensvolle Kommunikation,
- eine Abstimmung hinsichtlich der Maßnahmen und
- eine ganzheitliche und nachhaltige Betrachtung der Fälle."
Falls Sie Fragen im Nachgang zur Veranstaltung haben, können Sie sich jederzeit gerne unter info@kipni.niedersachsen.de an uns wenden.